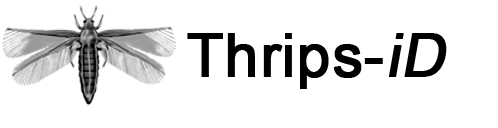Filippo Bonannis erste Beobachtung und Darstellung eines Fransenflüglers (1691)
Bonanni: Micrographia curiosa
Pater Filippo Bonanni oder auch Buonanni (7. Januar 1638 – 30. März 1723) war ein italienischer Jesuiten-Gelehrter. In seinem Werk »Micrographia curiosa, siue rerum minutarissimarum observationibus, quae ope microscopij recognitae ad viuum exprimuntur« (Beobachtungen kleinster Dinge, die mit dem Mikroskop erkannt werden), das 1691 publiziert wurde, beschreibt er zahlreiche mikroskopische Beobachtungen, u.a. viele Insekten, und stellt diese – durch die Gunst seiner ausgeprägten Begabung als Kupferstecher – in Radierungen detailliert und ästhetisch dar.
In seinem Kapitel über die Fliegen (Musca), beschreibt Bonanni Beobachtungen, die mit dem Anhaften der Beine dieser Insekten an glatten Gegenständen zusammenhängen. In seinen Ausführungen hierzu geht er auch auf winzige Tierchen ein, die er auf einer Witwenblume fand. Bonanni ordnete die kleinen, ihm unbekannten Insekten, den Fliegen zu. Tatsächlich aber handelte es sich eindeutig um Fransenflügler (vermutlich um eine Art aus der Gattung Haplothrips), wie sein Kupferstich belegt. Die morphologische Beschreibung ist kurz gehalten, beinhaltet aber die mit Fransen besetzten schmalen Flügel, die Bonanni für ungeeignet für den Flug darstellt. Wie oben genannt, war sein Fokus jedoch insbesondere auf die auffälligen blasenartigen Haftorgane an den Füßen der Tiere gerichtet, die ihnen ja auch später, in Carl de Geers Beschreibung der Ordnung (1744) den Namen Physopoda (Blasenfüße) einbringen sollten.
Im Folgenden findet sich eine Übersetzung aus dem ursprünglich lateinischen Text des Abschnitts, in dem der Fransenflügler beschrieben ist. (Als PDF-Datei stehen auch größere Teile des Kapitels Musca übersetzt zum Download bereit. Dieser Text wird nach und nach weiter ergänzt. Für Übersetzungsfehler wird ausdrücklich keine Garantie übernommen! Kritische Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.)
IV. Musca – Die Fliege
…
Fliegen heften Ihren Körper also nicht bloß mit den Krallen an, sondern dies Werk ist darüber hinaus unterstützt durch die Hilfe klebriger Feuchtigkeit, die aus den kleinen Kissen der Füße, beim Zusammendrücken, gleichsam Schweiß ausfließt und in den Härchen der selben gehalten wird.
Diese Beobachtung bestärkt in allem eine andere, die ich nun anfüge. Als ich Cyanum Turcicum [Anmerkung: Witwenblume (Knautia sp.)] beobachtete, im Volksmund Fior d’ambretta genannt, wegen ihrem entzückenden Geruch, welcher duftet; bemerkte ich einige schwarze Punkte, in träger Bewegung auf den Blättchen auseinanderlaufen. Das Mikroskop offenbarte mir unbekannte Insekten, wie in Nummer 38 abgebildet. Der Rumpf besteht aus den Teilen, Kopf, Rücken, Bauch, hinter dem zum Schwanz hin gerichtet sieben Ringe folgen. Sie sind mit sechs Beinen versehen, deren zwei unterste am Bauch angebracht sind. Die vier anderen an der Brust; in Abschnitte geteilt, wie in der Abbildung gezeigt. Vom Kopf erstrecken sich zwei Fühler, in sieben Abschnitte gefaltet. Am Rücken sind zwei Flügel angebracht, mit den Flächen derart befestigt, dass sie niemals entfaltet werden können. Sie haben deshalb keine Flügelhaut, sondern lediglich lange, stachlige, rabenschwarze Haare, die sie manchmal emporheben, wie ein Stachelschwein seine Stacheln. Aber wieder zu unserer Sache. Die vier Enden der vorderen beiden Beinpaare gleichen, so sie entfaltet sind, membranösen durchsichtigen Beuteln. Diese brauchte das Tier, um sich am Glas anzuheften; wann immer es kroch verdoppelten sich diese Beutelchen in ihrer Ausdehnung; und es drückte jene auf die Oberfläche des Glases, um auf diese Weise schnellstens anhaftend fortzuschreitend, wodurch in dieser Bewegung die hintersten Beine unnütz waren, weil Ihnen die kleinen befeuchteten Kissen fehlten, und wenn sie auch ans Glas aufgesetzt wurden, rutschten sie auf der Stelle, wegen der Glätte, weg. Ein ähnliches Straucheln der Beine habe ich bei Läusen und Flöhen und anderen Arten Insekten, die zwischen zwei gekrümmten Gläsern eingeschlossen waren, beschrieben, obgleich sie mit langen, gebogenen und festen Krallen ausgestattet sind. Neugierig auf den Versuch, setzte ich ein Exemplar dieses Geschlechts auf eine gläserne, perfekt glatte Oberfläche; annehmend, dass das Tier sicher herabfällt, wenn ich diese anhebe und so drehe, dass der Teil, auf dem das Tier ist, eine waagerechte Fläche bildet; aber es verharrte lange Zeit wie eine Fliege, um dann die Scheibe uneingeschränkt und ohne den Sturz zu fürchten, zu durchlaufen. Freilich war mir das schon vielfach vorgekommen, wenn ich auf in Kolben eingeschlossene Bettwanzen zurückblicke; niemals konnten diese aber bei denselben zur Öffnung gelangen; denn, wenn sie bis dahin weitergingen, wo sich dieser seitlich ein bisschen gen senkrecht erhebt, rutschten sie sofort zum Grund.
…
(Übersetzung: M.R. Ulitzka)
Thrips-iD durchsuchen
Collection Ulitzka
Neu hinzugefügt
Forschungsergebnisse
Fotos: Schadbilder
NEU: Fraß- & Schadspuren
Zoom-In-Fotos
NEU: Aeolothrips intermedius
NEU: Hercinothrips aethiopiae
NEU: Thrips atratus
Check all